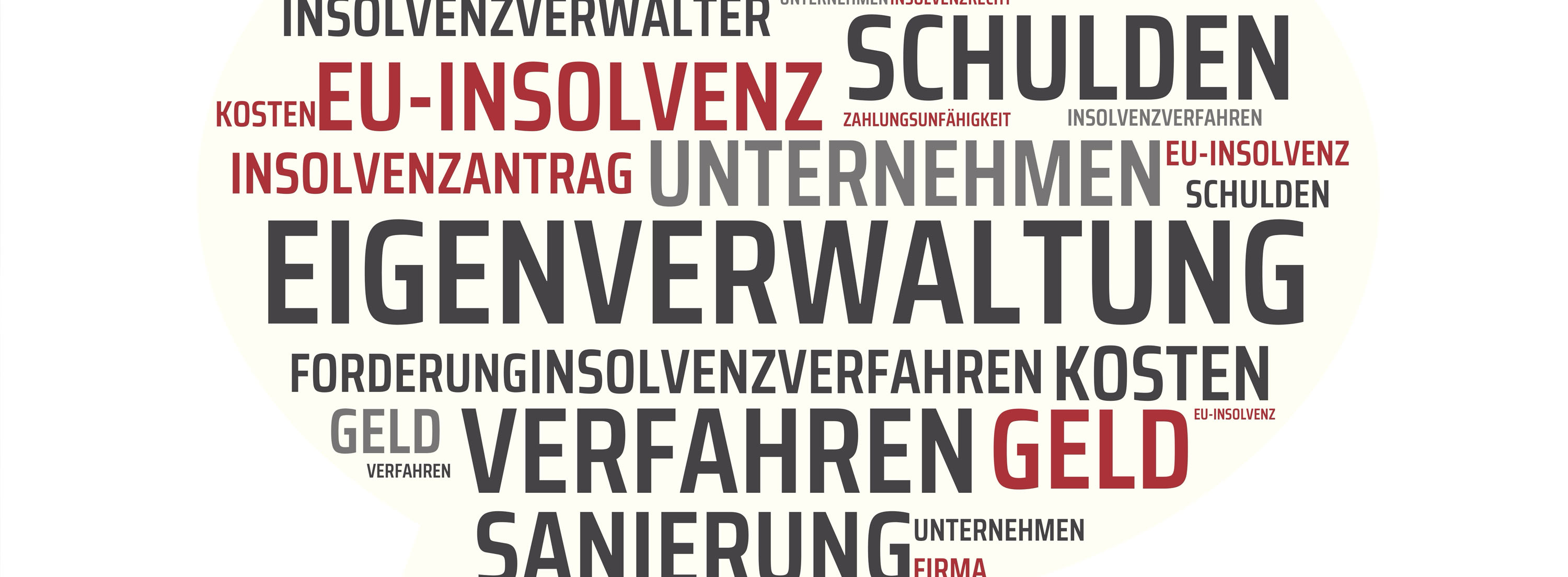
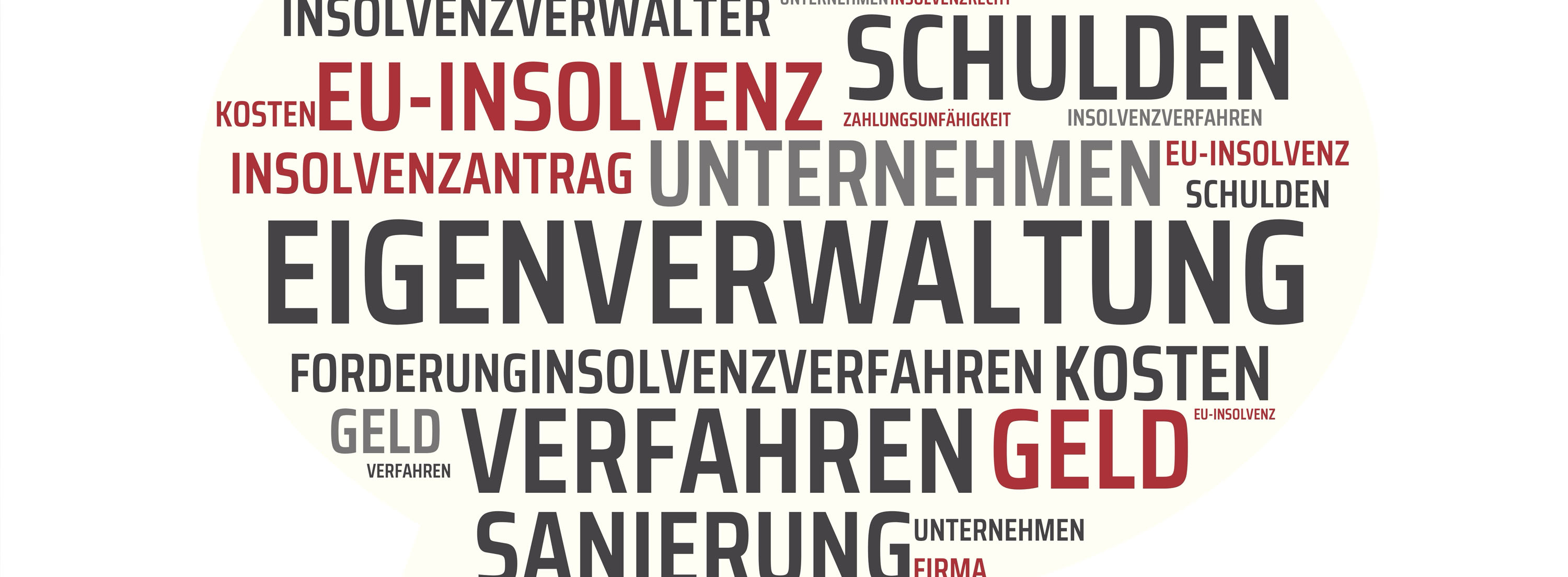
Die Insolvenz in Eigenverwaltung ist ein gezielter Sanierungsweg für Unternehmer, die frühzeitig handeln und Verantwortung übernehmen wollen. Für Geschäftsführer bedeutet sie die Chance, die Kontrolle über das eigene Unternehmen zu behalten und gleichzeitig die Weichen für eine nachhaltige Restrukturierung zu stellen.
11/04/2025 Industrie, Insolvenz
Anders als bei der klassischen Regelinsolvenz wird das Verfahren nicht vollständig durch einen externen Insolvenzverwalter geführt. Stattdessen bleibt die Geschäftsführung weiterhin im Amt, begleitet von einem gerichtlich eingesetzten Sachwalter, der die wirtschaftliche Entwicklung überwacht.
Dieser Kontrollmechanismus schafft Vertrauen bei den Gläubigern, ohne den operativen Handlungsspielraum des Unternehmens vollständig einzuschränken. Die Eigenverwaltung richtet sich daher an Unternehmer, die ihr Unternehmen aktiv sanieren möchten und in der Lage sind, diesen Prozess organisatorisch wie wirtschaftlich zu führen.
Eine Eigenverwaltung setzt voraus, dass das Unternehmen sich nicht in akuter Zahlungsunfähigkeit, sondern in einer wirtschaftlich kritischen, aber noch steuerbaren Lage befindet. Juristisch betrachtet kommen zwei Konstellationen infrage:
In diesen Phasen besteht die Möglichkeit, rechtzeitig ein Eigenverwaltungsverfahren zu beantragen und ein Schutzschirmverfahren vorzuschalten – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.
Die Eigenverwaltung ist ausschließlich für juristische Personen oder gleichgestellte Unternehmensformen zugänglich. Einzelunternehmer ohne rechtliche Trennung zwischen Geschäfts- und Privatvermögen sind in der Regel ausgeschlossen. Auch Unternehmen, bei denen keine realistische Aussicht auf Sanierung besteht oder die keine vollständige, belastbare Finanzplanung vorlegen können, werden vom Gericht nicht zugelassen. Entscheidend ist, dass das Unternehmen sanierungsfähig, sanierungswürdig und organisatorisch in der Lage ist, den komplexen Ablauf zu steuern.
Die Antragstellung auf Eigenverwaltung ist formal wie inhaltlich anspruchsvoll. Bereits bei der Einreichung prüft das Insolvenzgericht, ob das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat. Dafür müssen u. a. ein vollständiger Insolvenzantrag, ein aussagekräftiger Finanzstatus, eine Liquiditätsplanung sowie ein schlüssiger Sanierungsansatz vorgelegt werden. Es darf keine Hinweise auf Pflichtverletzungen der Geschäftsführung geben – etwa verspätete Insolvenzanmeldung, unvollständige Buchführung oder unkooperative Gläubigerkommunikation. Zudem muss das Vertrauen der Gläubigervertreter vorhanden sein, da das Gericht deren Zustimmung bei der Anordnung berücksichtigt.
Je früher der Antrag vorbereitet wird, desto größer sind die Erfolgschancen. Unternehmer, die sich erst dann mit dem Thema beschäftigen, wenn der Betrieb faktisch zahlungsunfähig ist, haben kaum noch Einfluss auf den Verlauf des Verfahrens und werden fast immer in die Regelinsolvenz überführt.
Wird die Eigenverwaltung bewilligt, eröffnen sich wichtige Gestaltungsspielräume. Die Geschäftsleitung behält das operative Steuer in der Hand und kann aktiv entscheiden, wie und in welchen Bereichen das Unternehmen neu ausgerichtet wird. Durch die begleitende Überwachung des Sachwalters entsteht ein rechtssicherer Rahmen, der sowohl Gläubigerschutz als auch Unternehmerinteressen berücksichtigt.
In dieser Phase kann das Unternehmen von zahlreichen Maßnahmen profitieren. So sichert das Insolvenzgeld die Löhne der Belegschaft in den ersten drei Monaten, während gleichzeitig neue Investoren gewonnen, unrentable Verträge beendet oder Geschäftsbereiche abgespalten werden können. Auch Finanzierungen sind unter bestimmten Bedingungen weiterhin möglich – zum Beispiel über Massekredite oder über Verwertungserlöse, etwa durch eine strategische Industrieauktion von nicht mehr betriebsnotwendigen Assets.
Ein entscheidender Vorteil: Die Gläubiger können während des Verfahrens keine Einzelvollstreckung betreiben. Das Unternehmen gewinnt Zeit und Luft für eine strukturierte Neuordnung, ohne permanent unter dem Druck neuer Pfändungen zu stehen.
Kriterium | Regelinsolvenz | Eigenverwaltung |
|---|---|---|
Kontrolle über das Unternehmen | Insolvenzverwalter übernimmt | Geschäftsführung bleibt im Amt |
Gläubigerbeteiligung | über den Insolvenzverwalter | direkter Kontakt mit Gläubigern möglich |
Typischer Ablauf | standardisiert, weniger flexibel | individuelle Sanierungskonzepte umsetzbar |
Vertrauensvoraussetzung | irrelevant | hohes Maß an Vertrauen notwendig |
Zielrichtung | oft Verwertung / Liquidation | Fortführung & Sanierung |
Trotz aller Chancen bleibt die Eigenverwaltung ein hochsensibles Verfahren mit hohem Haftungs- und Reputationsrisiko. Wird der Sanierungsplan nicht realistisch aufgesetzt, scheitert die Umsetzung an operativen Fehlern oder fehlt der Rückhalt der Gläubiger, droht der sofortige Übergang in die Regelinsolvenz – inklusive vollständigem Kontrollverlust.
Auch in der Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsleitung verpflichtet, insolvenzrechtliche Vorgaben strikt einzuhalten. Das betrifft insbesondere die Masseerhaltungspflicht, die lückenlose Buchführung und die Pflicht zur Transparenz gegenüber Gericht und Gläubigern. Wer in dieser Phase strategische Fehler begeht oder gar bewusst Informationen zurückhält, riskiert nicht nur die Ablehnung des Verfahrens, sondern auch persönliche Konsequenzen bis hin zur Haftung.
Zudem ist der Aufwand organisatorisch und rechtlich erheblich. Ohne externe Berater mit Erfahrung im Insolvenzrecht und in der betriebswirtschaftlichen Sanierung ist das Verfahren kaum erfolgreich zu steuern. Unternehmen sollten frühzeitig Restrukturierungsexperten, Sanierungsgutachter und Auktionspartner einbinden, um die Vermögenswerte effizient zu sichern und neue Liquidität zu schaffen.
Erste Warnsignale zeigen sich oft Monate vor einer Insolvenz. Sie reichen von steigenden Außenständen über dauerhaft verspätete Lohnzahlungen bis hin zu schwindendem Vertrauen bei Lieferanten oder Kreditgebern. Auch zunehmende Unruhe in der Belegschaft oder nicht einlösbare Finanzierungszusagen sind klare Indikatoren für strukturelle Schieflagen.
Wird in dieser Phase zugewartet oder auf kurzfristige Überbrückungen gesetzt, verliert das Unternehmen nicht nur Zeit, sondern auch Handlungsspielräume. Die Eigenverwaltung funktioniert nur, wenn frühzeitig reagiert wird – mit einem klaren Blick auf Zahlen, Szenarien und Alternativen.
Besonders wirksam ist das sogenannte Schutzschirmverfahren. Es stellt eine Sonderform der Eigenverwaltung dar, die bereits vor der eigentlichen Insolvenz beantragt wird, um Zeit für einen Sanierungsplan zu gewinnen. Ein solches Verfahren setzt voraus, dass noch keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt – dafür aber eine drohende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Die Vorteile: keine Gläubigerzugriffe, gezielte Vorbereitung des Insolvenzplans, geordnete Kommunikation mit Banken, Lieferanten und Mitarbeitern.
Das Schutzschirmverfahren ist auf maximal drei Monate begrenzt. Innerhalb dieses Zeitraums muss ein tragfähiger Plan stehen, der sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich überprüfbar ist. Nur dann kann der Übergang in die eigentliche Eigenverwaltung nahtlos erfolgen – ohne Kontrollverlust oder Glaubwürdigkeitsverlust.
Wer sein Unternehmen in der Krise aktiv retten möchte, findet in der Eigenverwaltung ein wirkungsvolles Werkzeug. Sie bietet Schutz, Struktur und strategische Optionen – aber nur, wenn sie frühzeitig, realistisch und professionell angegangen wird. Unternehmer, die zu lange zögern oder sich auf juristische Halbwahrheiten verlassen, verlieren diese Chance unwiderruflich.
AssetOrb unterstützt seit Jahren Insolvenzverwalter, Geschäftsführer und Restrukturierungsberater bei der realistischen Bewertung und gezielten Verwertung industrieller Assets. Unsere Auktionen und Gutachten sichern Liquidität, schaffen Transparenz und ermöglichen den wirtschaftlich sinnvollen Neustart.